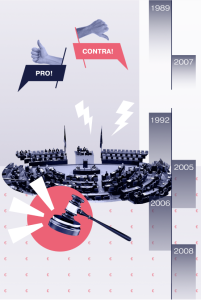Kapitel 3
Eine bessere Schuldenbremse ist möglich







Die Diskussion
um die Schuldenbremse
Ganz unumstritten war die Schuldenbremse eigentlich nie. Die Wirtschaftsweisen hatten sich schon bei der Einführung für eine andere Regel ausgesprochen .
Trotzdem sah die Schuldenbremse lange wie eine Erfolgsgeschichte aus: Die Schuldenquote und die Zinsen fielen und gleichzeitig schien der Staat mit seinem Geld gut auszukommen. Die Argumente der Befürworter:innen der Schuldenbremse standen lange unhinterfragt im Raum.
Heute ist die Situation eine andere: Der Staat kommt mit dem ihm im Rahmen der Schuldenbremse zur Verfügung stehenden Geld eindeutig nicht aus. Die Bedarfe für die Dekarbonisierung, Verteidigung und andere – lange vernachlässigte – öffentliche Güter wie die Bahn oder Bildung sind zu groß.
Die Bundesregierung legt daher maximale haushalterische Kreativität (z. B. Sondervermögen) an den Tag, um das nötige Geld aufzubringen, ohne gegen die Schuldenbremse zu verstoßen. Das hat die Diskussion um die Schuldenbremse befeuert.
Sollte man die Schuldenbremse abschaffen?
Die Hürden für die Abschaffung der Schuldenbremse sind sehr hoch. Dafür wären Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig, die zu erreichen sehr unwahrscheinlich sind.
Zudem gibt es einen weiteren wichtigen Faktor: So wie Geld, Banken und das Finanzwesen im Allgemeinen, bauen auch Staatsanleihen stark auf Vertrauen auf. Sie sind unter anderem so beliebt, weil breite Zuversicht in ihre Werthaltigkeit besteht. Auch die Schuldenbremse genießt ein hohes Vertrauen. Das mag sachlich unbegründet sein, spielt aber eine wichtige psychologische Rolle. Sollte die Schuldenbremse abgeschafft werden, müssten Bevölkerung und Finanzakteur:innen überzeugt werden. Es bräuchte plausible Argumente, dass andere bestehende bzw. neue Regeln, Verfahren oder Institutionen langfristig besser für nachhaltige Finanzen sorgen.
Letztlich müsste man aufgrund europäischer Bestimmungen eine alternative Finanzregel vorschlagen, wenn man die Schuldenbremse abschafft. Man sollte eine gute Antwort parat haben darauf, wie diese aussehen könnte.





Wiederkehrende Streitpunkte zur Schuldenbremse





Die politische und öffentliche Debatte um die Schuldenbremse dreht sich wiederholt um die gleichen Punkte. Im Folgenden greifen wir die prominentesten Themen auf und entkräften die Argumente der Reformgegner:innen.
Möchte man die Schuldenbremse selbst nicht reformieren, braucht aber mehr Verschuldungsspielraum, hat man zuletzt versucht mittels Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbeizukommen.
Dieser Weg ist seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. November 2023 so nicht mehr möglich. Bis dahin war die Bundesregierung davon ausgegangen, dass sie im Rahmen einer Notlage Schulden aufnehmen, in einem Sondervermögen wie dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) „zurücklegen“, und dann diese Gelder ohne Anrechnung auf die Schuldenstatistik in zukünftigen Jahren nutzen kann. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt.
Weiterhin von der Schuldenbremse ausgenommen sind selbstständige Sondervermögen, die selbst Kredite aufnehmen dürfen, wenn sie vor der Schuldenbremse geschaffen wurden.
Ebenfalls ist es weiterhin möglich, ein Sondervermögen mit Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz zu schreiben und dieses explizit von der Schuldenbremse auszunehmen. Diesen Weg hat man beispielsweise beim 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr gewählt.
Neben den zusätzlichen rechtlichen Problemen seit dem Urteil, ist eine grundlegende Kritik an der Nutzung von Sondervermögen oder Schattenhaushalten, dass sie leicht zu Intransparenz führen und so der Demokratie schaden können.
Eines der häufigsten Argumente für die Schuldenbremse ist die These, dass von einer Generation hinterlassene Staatsschulden nicht gerecht seien für die nächste. Das kann zutreffen, insbesondere wenn die Schulden mit hohen Zinskosten verbunden sind und das geliehene Geld in kurzfristigen Konsum fließt.
Die These übersieht aber, dass unterlassene Investitionen – zum Beispiel in Bildung oder Klimaschutz – auch eine Bürde für die nächste Generation darstellen. Ob zusätzliche Schulden oder fehlende Schulen das größere Problem sind, lässt sich nicht pauschal beantworten.
Staatsschulden werden auch deshalb kritisch gesehen, weil man Sorge hat, dass die Zinskosten Spielräume für andere Ausgaben beschneiden. Ende der 1990er Jahre flossen zum Beispiel 17 % des Bundeshaushalts in Zinszahlungen. Bereits Anfang der 2000er Jahre – noch vor der Einführung der Schuldenbremse – fielen die Zinsausgaben. Heute sind sie im niedrigen einstelligen Bereich, zuletzt zwischen 1 und 4 %.
In den letzten Jahren war die Neuverschuldung aber kein Kostenfaktor, im Gegenteil: Die Bundesregierung hat mit der Aufnahme neuer Schulden Geld verdient. Investoren haben den Staat dafür bezahlt, sich zu verschulden. Sich nicht zu verschulden, war vergleichbar damit, das Erbe der nachfolgenden Generationen nicht zu investieren – obwohl man sowohl vom Finanzmarkt dafür bezahlt worden wäre als auch sinnvolle Investitionen damit hätte tätigen können.
Stand 2023 entsprechen die Zinsen auf Neuschulden ungefähr der erwarteten Inflation. Der Bund verdient nicht mehr an der Aufnahme neuer Schulden, muss gleichzeitig aber nur so viel zahlen, wie die Inflation an Steuermehreinnahmen bringt. Sie sind jetzt also kostenneutral. Die Schuldenbremse berücksichtigt sich verändernde Finanzierungskosten nicht. Sie geht generell davon aus, dass Schulden den Staat etwas kosten. Das stimmt nicht immer.
Die meisten Schulden nimmt der deutsche Staat auf, indem er Staatsanleihen ausgibt. Um einzuschätzen, ob eine Staatsanleihe den Staat kostet oder ob er damit Gewinn macht, bedarf es viererlei Information.
Erstens: der Zinssatz der Anleihe. Den zahlt der Staat jedes Jahr an den Investor, der die Anleihe hält. Zweitens: die erwartete Inflation. Liegt der Zins unter der Inflation, verliert der Investor Geld, der Staat macht einen Gewinn. Drittens: die Laufzeit der Staatsanleihe, also wann der Staat dem Investor die Anleihe spätestens wieder abkauft.
Viertens: der Ausgabepreis der Anleihe. Denn eine Staatsanleihe, die einem Kredit von 100 Euro entspricht, wird nicht unbedingt zu 100 Euro verkauft. Gibt es gerade wenig Nachfrage, wird sie zum Beispiel zu 90 Euro verkauft. Der Staat bekommt dann nur 90 Euro vom Investor, muss ihm aber 100 Euro zurückzahlen, wenn die Anleihe fällig wird. Gibt es viel Nachfrage, kann der Staat eine Anleihe mit Wert 100 Euro für 120 Euro verkaufen. Selbst wenn der Zinssatz dann hoch ist, macht der Staat eventuell einen Gewinn.
Auf Basis dieser vier Faktoren – Zins, erwarteter Inflation, Laufzeit und Ausgabepreis – lässt sich der Gegenwartswert der Staatsanleihe berechnen. Liegt der Wert unter 100, verdient der Staat an der Anleihe. Liegt er über 100, verdient der Investor. Mehr dazu hier .
Die Schuldenbremse wird manchmal als Inflationsbremse bezeichnet, die verhindert, dass der Staat die Wirtschaft übermäßig befeuert. Prinzipiell ist das richtig. Die Schuldenbremse ist so ausgestaltet, dass sie die zulässige Neuverschuldung auf Basis der wirtschaftlichen Auslastung schätzen soll (siehe Kapitel 2).
Es gibt jedoch Probleme: Erstens ist für die Wirtschaft nicht relevant, ob die Schuldenbremse eingehalten wird, sondern wie stark der Staat sich tatsächlich neuverschuldet. Findet die Regierung einen schlauen Weg und verschuldet sich umfangreich, trotz Einhaltung der Schuldenbremse, wird die Inflation nicht gebremst. Wege an der Schuldenbremse vorbei sind in diesem Kapitel beschrieben.
Zudem bremst die Schuldenbremse in ihrer heutigen Ausgestaltung die Wirtschaft ziemlich willkürlich ab und steht der Mobilisierung aller vorhandenen Arbeitsmarktpotenziale im Weg. Das wirkt mittelfristig eher inflationstreibend: Gibt es strukturell weniger Arbeitskräfte, weil lange weniger ausgebildet wurde oder zu wenig Kitaplätze geschaffen wurden, haben in einem Aufschwung die existierenden Arbeitskräfte eine größere Verhandlungsmacht in Gehaltsverhandlungen. Die Löhne steigen und damit die Preise. Es kommt zur Inflation.
Ähnliche Effekte können durch ausbleibende Investitionen verursacht werden: Wird jahrelang nicht genügend in Infrastruktur investiert, kann diese in einer wirtschaftlichen Stärkephase schnell zu einem Flaschenhals werden, der die Preise in die Höhe treibt.
Bei Einführung der Schuldenbremse wurde argumentiert, dass sie einen zentralen Fehler von Demokratien korrigiert: den ungebremsten Drang der Politik zum Geld ausgeben. Nicht zuletzt, um wiedergewählt zu werden.
Schon der Befund ist umstritten: Von der Einführung der Schuldenbremse 2009 bis Ende 2019 – dem bis dato letzten Jahr ohne Notlage oder kreativer Buchhaltung – reizte die Bundesregierung ihren Schuldenspielraum nie aus.
Ob die Schuldenbremse effektiv bremst, sei dahingestellt: Als die Bundesregierung zusätzliches Geld dringend brauchte, hielt die Schuldenbremse sie nicht auf. Mit viel Kreativität fand man die nötigen Summen.
Offen bleibt, ob die Einhaltung eines bestimmten Verschuldungsrahmens mit disziplinierter Haushaltspolitik gleichzusetzen ist. Ein Unternehmen, das notwendige und wichtige Investitionen nicht tätigt, wird tendenziell als untätig und denkfaul eingestuft – nicht als diszipliniert und strategisch.
Die Befürworter der Schuldenbremse argumentieren, dass sie die Handlungsfähigkeit demokratisch gewählter Regierungen in der Zukunft schützt, indem sie der Politik heute eine Verschuldungsgrenze setzt.
Das schafft sie aber nur, indem sie das Königsrecht des Parlaments einschränkt: Das Recht über den Bundeshaushalt zu bestimmen. Das tut sie ohne klaren Sachgrund. Man kann ökonomisch nicht sagen, ob es immer schlechter ist, sich mehr zu verschulden als unter der Schuldenbremse zulässig.
Zudem verschiebt die Schuldenbremse Macht vom Parlament hin zur Bundesregierung. Denn deren Fachleute bestimmen die Ausgestaltung der Potenzialrechnung (siehe Kapitel 2) und damit de facto die maximal zulässige Neuverschuldung. Insbesondere die Definition des Arbeitspotenzials erfordert auch politische Entscheidungen, zum Beispiel ob man das Potenzial bereits für erreicht hält, wenn Frauen nur so viel arbeiten wie früher und damit wesentlich weniger als Männer. Oder ob man es erst für erreicht hält, wenn Frauen und Männer ungefähr gleichermaßen am Arbeitsmarkt beteiligt sind.
Diese politischen Entscheidungen werden aktuell aber nicht vom Parlament getroffen, sondern von technischen Expert:innen im Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium.
Eine oft erwähnte Reformmöglichkeit bestünde darin, Investitionen wie früher von der Schuldenbremse auszunehmen. Befürworter:innen einer solchen Reform argumentieren, dass man damit weiterhin Ausgabendisziplin sicherstellen könne, ohne Investitionen zu beeinträchtigen.
Dieser Vorschlag hat mehrere Haken. Erstens: Viel hängt davon ab, wie man Investitionen definiert. Heute zählen nur Ausgaben für physische Güter, zum Beispiel eine Straße oder Finanzprodukte, als Investition. Die Finanzierung von Erziehungspersonal hingegen nicht. Eine gute allgemeingültige Definition ist schwierig: Am Ende bestimmt oft der Kontext, ob ausgegebenes Geld künftig Wohlstand generiert – also investiven Charakter hat. Nur anhand der Art der Ausgabe lässt sich das nicht sagen.
Zweitens: Bisher ist die Mechanik der Schuldenbremse so ausgerichtet, dass sie eine Überlastung der Wirtschaft und damit Inflation vermeidet: Die zulässige Neuverschuldung wird danach ausgerichtet, wie sehr die Wirtschaft unter- bzw. überausgelastet ist. Klammert man Investitionen aus, fällt dieser Schutz vor Inflation weg. Wie wirksam er jedoch ist im Vergleich zu anderen Inflationsblockern, ist unter Fachleuten umstritten. Mit unserem heutigen Wissen würde man einen effektiven Inflationsschutz wahrscheinlich anders gestalten, siehe Ausführungen zu „Investitionen und Inflation“.
Abgesehen von den technischen Herausforderungen erfordert eine Investitionsregel eine Grundgesetzänderung. Diese ist nur mit Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat möglich.
Zuletzt ist unklar, ob eine Investitionsregel der Bundesregierung überhaupt zusätzlichen Spielraum verschaffen würde und falls ja, wie viel.
Wie in Kapitel 1 beschrieben, ist der Gedanke hinter einer Investitionsregel – auch Goldene Regel genannt – dass Ausgaben, die unseren Wohlstand mehren, mit Schulden finanziert werden dürfen. Denn dann steht am Ende der Verschuldung zusätzliches Vermögen gegenüber. Die meisten Investitionen des Bundes schaffen aber kein zusätzliches Vermögen auf Bundesebene, sondern sind Zuschüsse für Länder, Kommunen oder Unternehmen. So gibt der Bund zum Beispiel das Geld für die Förderung von Elektrobussen aus, aber am Ende sind es die Kommunen, die den Bus besitzen. In diesem Fall würde eine Investitionsregel dem Bund keinen zusätzlichen Verschuldungsspielraum eröffnen.
Dieses Problem ließe sich nur mit einer Schuldenregel umgehen, die alle föderalen Ebenen einschließt.
Die Schuldenbremse in ihrer heutigen Form soll Inflation verhindern, indem sie die Neuverschuldung insgesamt begrenzt. So soll vermieden werden, dass es zu viel Nachfrage nach Arbeit gibt, Beschäftigte eine zu starke Position in Lohnverhandlungen haben, die Löhne und damit die Preise zu stark steigen.
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt aber, dass Preissteigerungen auch ohne eine gesamtwirtschaftliche Überauslastung möglich sind. So stiegen zum Beispiel die Preise im Bausektor aufgrund knapper Kapazitäten viel schneller als in anderen Sektoren. Die Corona-Pandemie sorgte für angespannte Lieferketten, die russische Invasion der Ukraine für plötzliche Energieknappheit. Beides trieb einzelne Preise in ungeahnte Höhen, ohne dass eine gesamtwirtschaftliche Überauslastung vorlag.
Möchte man die Klimaziele einhalten, wird es in den nächsten Jahren notwendig sein, schnell Investitionen in einigen Bereichen (zum Beispiel für den Ausbau von Stromnetzen, Einbau von Wärmepumpen etc.) zu erhöhen. Das birgt das Risiko von Preissteigerungen in den jeweiligen Bereichen, auch wenn die Wirtschaft insgesamt nicht ausgelastet ist.
Neben Inflation ohne Überauslastung scheint umgekehrt auch Überauslastung ohne Inflation möglich. So wird seit mehreren Jahren ein Fachkräftemangel beanstandet, also eine Überauslastung im Arbeitsmarkt beklagt. Dennoch war keine breite Lohninflation zu beobachten.
Insgesamt ist also der Zusammenhang zwischen allgemeiner Wirtschaftsauslastung und Inflation wackeliger als gedacht. Daher sollte man überlegen, ob man, anstatt sich allein auf eine Begrenzung der Neuverschuldung zu verlassen, auch Preiseffekte einzelner Gesetze wieder stringent analysiert. Die Geschäftsordnung der Bundesregierung schreibt das übrigens bereits vor.
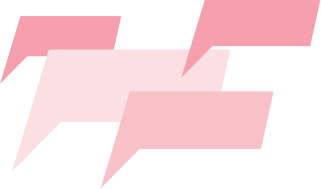


Alternative: Die Schuldenbremse modernisieren
Statt die Schuldenbremse kompliziert abzuschaffen, könnte man sie mit einfachen Mitteln modernisieren. Das Prinzip hinter der Schuldenbremse – die zulässige Neuverschuldung flexibel an der Auslastung der Wirtschaft auszurichten – ist an sich sinnvoll. Problematisch ist, wie die Auslastung der Wirtschaft derzeit bestimmt wird (siehe Kapitel 2).

Vertiefung im Abschnitt: „Alternative: Die Schuldenbremse modernisieren“
Aktuell wird das Potenzial der Wirtschaft auf Basis der vergangenen Wirtschaftsleistung berechnet. Haben Frauen im Durchschnitt in der Vergangenheit nur halb so viel gearbeitet wie Männer, gilt das Potenzial (etwas vereinfacht gesprochen) als erreicht, wenn Frauen auch in Zukunft halb so viel arbeiten wie Männer. Das ist weder fiskalpolitisch sinnvoll, noch gesellschaftlich erstrebenswert. Dem Ziel der Gleichstellung steht das diametral entgegen.
Wieso macht man das? Unter der Schuldenbremse versuchte man zwei Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Zum einen sollten keine dauerhaften Schulden aufgebaut werden. Zum anderen sollte die Regierung aber die Möglichkeit haben sich zu verschulden, um die Wirtschaft zu stützen, wenn sie unter Potenzial läuft, also Menschen weniger arbeiten als sie wollen und können.
Nun sind diese beiden Ziele – keine dauerhafte Verschuldung und eine stabilisierende Finanzpolitik – nicht zwingend kompatibel. Es könnte ja Zeiten geben, in denen die Wirtschaft länger unter Potenzial läuft und sich so Schulden auftürmen. Das vermeidet man, indem man das Potenzial mit der durchschnittlichen Wirtschaftsleistung der Vergangenheit gleichsetzt – also davon ausgeht, dass die Wirtschaft in der Vergangenheit im Durchschnitt ausgelastet war.
Das hilft, um die beiden Ziele unter einen Hut zu bringen. Denn die heutige Wirtschaftsleistung kann ja nicht dauerhaft von ihrem eigenen historischen Durchschnitt abweichen. Würde sich die Leistung heute stark erhöhen, würde das auch den Durchschnitt nach oben ziehen.
Nur ist die Annahme, dass die Wirtschaft in der Vergangenheit im Durchschnitt ausgelastet war, schwer haltbar. Schon 1986 argumentierten die Ökonomen Olivier Blanchard und Lawrence Summers, dass eine dauerhafte Unterauslastung der Wirtschaft möglich ist.
Die heutige Methodik zur Schätzung des Potenzials hilft also Schulden zu vermeiden, baut dazu aber auf einer empirisch schwer haltbaren Annahme auf.
Die Schuldenbremse nutzt nicht alle vorhandenen Arbeitspotenziale, weil sie problematische Annahmen macht: So geht sie davon aus, dass das Potenzial unabhängig von der tatsächlichen Politik ist, dass es einer gewissen Mindestarbeitslosigkeit bedarf und dass das Potenzial ungefähr der Wirtschaftsleistung der Vergangenheit entspricht – auch wenn Frauen aufgrund eines anderen Rollenverständnisses früher seltener einer bezahlten Arbeit nachgingen als sie es heute tun (oder gerne tun würden).
Das entspricht weder unserem gesellschaftlichen Wertekonsens, noch ist es finanziell nachhaltig. Es hilft auch nicht dabei, die Dekarbonisierung zu bewältigen – dafür brauchen wir alle verfügbaren Arbeitskräfte. Zudem ist sie nur bedingt demokratisch: Wichtige Werturteile, wie zum Beispiel die Bestimmung des Arbeitspotenzials von Frauen, fällen technische Fachleute im Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium und nicht das Parlament.
Es wäre also sowohl aus demokratischer als auch ökonomischer Perspektive sinnvoll, dass man überarbeitet, wie das Potenzial festgelegt wird. Anstatt dass Fachleute das Potenzial unabhängig von politischen Entscheidungen definieren, sollte der Gesetzgeber basierend auf dem Input der Fachleute – die den Einfluss der aktuellen Politik auf das Potenzial schätzen – entscheiden. Damit lägen die Werturteile wieder in der Hand des Gesetzgebers. Der hätte nun auch einen Anreiz, nachhaltige Politik zu machen: Erhöht er mit seiner Politik das Arbeitspotenzial, zum Beispiel durch den Ausbau der Kinderbetreuung, bekäme er mehr Kreditspielraum unter der Schuldenbremse.
Eine solche Reform wäre nicht nur sinnvoll, sondern auch ohne Grundgesetzänderung möglich. Mehr Informationen zu einer solchen Reform finden Sie hier.






Kleine Änderung, große Wirkung

Vertiefung im Abschnitt: „Kleine Änderung, große Wirkung“
Die Anpassung der Schätzung des Produktionspotenzials würde keine Grundgesetzänderung erfordern. Rechtlich ist wichtig, dass die Politik nachvollziehbar begründen können muss, wieso das projizierte Potenzial tatsächlich erreichbar ist.
Möchte man den Prozess anpassen, mittels dessen das Produktionspotenzial bestimmt wird, sollte das Ausführungsgesetz geändert werden. Das kann die Bundesregierung mit einfacher Mehrheit tun.
Ohne Gesetzesänderung ändern, lassen sich die Inputs zur Schätzung des Produktionspotenzials. Diese Inputs werden heute vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen bestimmt.
Die Methodik der Berechnung soll mit der von der EU genutzten Methodik übereinstimmen. Das scheint allerdings nicht die Inputs einzuschließen: Schon heute unterscheiden sich die Inputs, die die EU für Deutschland berechnet, von denen, die die deutschen Ministerien berechnen.
Mehr zum rechtlichen Hintergrund erfahren Sie hier.
Die Überarbeitung der Potenzialschätzung ist vergleichsweise einfach umsetzbar, hätte aber viele positive Auswirkungen: Es gäbe zum Beispiel einen aktiven Anreiz, Frauenerwerbstätigkeit zu fördern. Das würde die notwendige Bezuschussung der Rente mit staatlichen Mitteln begrenzen und so die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen stärken. Der Arbeitskräftemangel würde bekämpft. Es wäre einfacher, die Lücken bei Erziehungs- und Pflegepersonal zu schließen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass genug Arbeitskräfte für die Dekarbonisierung vorhanden sind.
Die Schuldenbremse wäre so außerdem ein wesentlich demokratischeres Instrument: Fragen zu „wie wollen wir leben bzw. arbeiten“, würden nun wieder im Parlament beantwortet. So, wie es sich in einer Demokratie gehört.