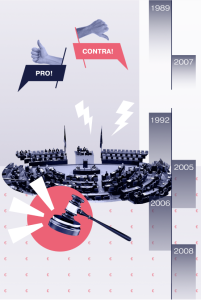Kapitel 1
Wie die Schuldenbremse in das Grundgesetz kam


1989



2007




Ein unzufriedenes Gericht
Deutschland hatte schon vor der Schuldenbremse eine Regel zur Begrenzung der Staatsverschuldung im Grundgesetz. Die ließ Neuverschuldung zu, aber nur für zwei Zwecke: um Investitionen zu finanzieren und für die Konjunktursteuerung, also um die Wirtschaft anzukurbeln, falls sie gerade besonders schlecht läuft.

Mit dieser Regel war das Bundesverfassungsgericht unzufrieden [siehe „Die alte Schuldenregel“]. In einem Urteil aus dem Jahr 1989 befand es die Regel als zu schwammig. Doch weder das Gericht noch die Regierung wollten in Reaktion hierauf die Neuverschuldung zahlenmäßig präzise begrenzen. Es sei richtig, dass der Bund für Investitionen und zur Konjunktursteuerung Schulden machen könne. In was für einer Höhe, dafür liefere „die Volkswirtschaftslehre … keine eindeutigen und sicheren Festlegungen“. Die Regeln sollten stattdessen durch ein besseres Haushaltsverfahren und striktere Rechenschaftspflichten gestärkt werden.

Vertiefung im Abschnitt: „Ein unzufriedenes Gericht“
Für den Bund war in Artikel 115 Grundgesetz festgelegt, dass die Neuverschuldung im Prinzip nicht die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Bruttoinvestitionen überschreiten darf. Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts war jedoch eine höhere Neuverschuldung zulässig. Diese Regelung ließ aus zwei Gründen einen breiten Ermessensspielraum für Neuverschuldung:
Erstens erlaubte sie Schulden in Höhe der kompletten Investitionen und auch von Ersatzinvestitionen (zum Beispiel die Ausgaben für ein neues Schulhaus, nachdem das alte abgerissen war). Das wurde vom Gericht als Konstruktionsfehler gesehen. Eigentlich war die Idee, dass Investitionen mit Schulden finanziert werden dürfen, wenn sie zusätzlichen Wert schaffen. Also zum Beispiel ein weiteres Schulhaus gebaut wird. Dann stünde der Schuld ein neuer Wert gegenüber.
Zweitens stellte das Gericht fest, dass niemand so genau sagen konnte, wann eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorlag (oder auch nicht) und mit welcher Höhe an Neuverschuldung man die Störung abwehren sollte. In Ermangelung objektiver Antworten forderte das Gericht hier jedoch nur, dass Rechenschaftspflichten nachzuschärfen sind. Wie Die Zeit damals schrieb: „wie sollen Juristen die Begriffe ‚Investition‘ und ‚Gleichgewicht‘ definieren, wo sich die Ökonomen nicht darauf einigen können.“
Auch wenn die damalige Schuldenregel generell als zu großzügig angesehen wurde, sah man sie an einem Punkt als zu eng an: Als „Investition“ galten nur Ausgaben in ‚Beton‘, nicht aber Investitionen in ‚Köpfe‘, wie zum Beispiel Bildung. Das ist heute noch so.

Vertiefung im Abschnitt: „Ein unzufriedenes Gericht“

1989 forderte das Bundesverfassungsgericht, dass der Gesetzgeber die alte Schuldenregel und insbesondere die Definition von Investitionen präzisieren solle.
Gleichzeitig akzeptierte das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil die Grundsätze einer vorherigen Verfassungsreform: 1969 hatte der öffentliche Haushalt eine zweite Funktion erhalten. Neben der Finanzierung von Staatsaufgaben sollte er nun helfen, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zu wahren.
Diese Rolle erhielt der Haushalt, da seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre klar war, dass Wirtschaften unter dauerhaftem Nachfragemangel und deshalb Unterauslastung leiden können. Dann sind Menschen arbeitslos und Fabriken stehen still, es wird weniger produziert als möglich wäre. Anders als vor 1929 geglaubt, gab es in den 1930ern keine automatische Selbstreparatur der Wirtschaft: Sie fand nicht von allein zurück zur Vollauslastung.
Aufgrund der Größe und Bedeutung des Bundeshaushalts kann dieser in einer solchen Situation helfen, die Wirtschaft zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Dies tut er durch eine Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage: indem der Staat bewusst mehr ausgibt als er einnimmt und so ein staatliches Defizit anstrebt, das dann durch Verschuldung gedeckt wird. Diese neue Funktion nennt sich Konjunkturpolitik und wurde vom Bundesverfassungsgericht 1989 als legitim anerkannt: „Der Staatshaushalt ist wegen seines Umfangs ein gewichtiger Faktor für das Wirtschaftsleben und kann als konjunktursteuerndes Instrument eingesetzt werden“.
Damit gute Konjunkturpolitik nicht durch eine falsche numerische Obergrenze unmöglich gemacht werde, sprachen sich damals sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch die Bundesregierung gegen eine solche Grenze aus. Die Volkswirtschaftslehre liefere „keine eindeutigen und sicheren Festlegungen“ dafür. Sowohl in der Normallage als auch in einer Wirtschaftskrise gäbe es „keinen allgemein anerkannten Maßstab dafür, in welcher konkreten Höhe die staatliche Kreditaufnahme … angemessen ist“.

2007 erneuerte das Gericht seine Kritik. Es sei mittlerweile eine „langfristig besorgniserregende Entwicklung des Schuldenstandes“ zu beobachten. Daher bestehe Reformbedarf.

Vertiefung im Abschnitt: „Ein unzufriedenes Gericht“
In seinem Urteil von 2007 musste das Bundesverfassungsgericht unter anderem klären, ob die Neuverschuldung im Bundeshaushalt von 2004 höher war, als die alte Schuldenregel es zuließ.
Das Gericht stellte fest, dass der Haushalt zwar verfassungskonform war, dass jedoch „an der Revisionsbedürftigkeit der geltenden verfassungsrechtlichen Regelungen gegenwärtig kaum noch zu zweifeln“ war. Die Haushaltspolitik der letzten 40 Jahre habe „praktisch durchgehend einseitig zur Vermehrung der Schulden beigetragen“. Die bestehende Schuldenregel habe sich „als verfassungsrechtliches Instrument rationaler Steuerung und Begrenzung staatlicher Schuldenpolitik in der Realität nicht als wirksam erwiesen.“
Daher gebe es Reformbedarf für die Schuldenregel. Entgegen dem lauten Grummeln des Gerichtes über den in seinen Augen hohen Schuldenstand betonte es aber gleichzeitig, dass selbst „eine langfristig besorgniserregende Entwicklung des Schuldenstandes … nicht die verfassungsrechtliche Kompetenz des Gesetzgebers zu einer situationsabhängigen diskretionären Fiskalpolitik“ beeinträchtigt. Im Einklang mit dem Urteil von 1989 bestätigte es damit die Legitimität einer konjunktursteuernden Haushaltspolitik.
1992

2005

2006

2008

Staatsschulden in der Europäischen Union
Auf europäischer Ebene gibt es seit dem Beschluss im Jahr 1992, den Euro einzuführen, Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung. Demnach sollen Staaten auf eine Schuldenquote von maximal 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) hinarbeiten und die Neuverschuldung auf maximal 3% des BIPs beschränken. Anfang der 2000er Jahre wurden diese jedoch auf die Probe gestellt. Deutschland und Frankreich brachen die 3%-Regel, um eine Rezession zu bekämpfen. Das Regelwerk erwies sich in der Praxis als zu starr. Eine Reform beziehungsweise Erweiterung der Regeln schien notwendig. 2005 konnte man sich einigen.

Vertiefung im Abschnitt: „Staatsschulden in der Europäischen Union“
Auf EU-Ebene wurden die Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung eingeführt, als man sich einigte, eine gemeinsame Währung, den Euro, einzuführen. Das war kein Zufall, sondern wichtig, um eine zentrale Herausforderung einer Währungsunion anzugehen: die Existenz zweier gegenläufiger Anreize, die eine angemessene Haushaltspolitik erschweren.
Einerseits haben Staaten in einer Währungsunion einen Anreiz, zu viele Schulden zu machen. In Staaten mit eigener Währung führt eine übermäßige Kreditaufnahme zur Inflation und zu übermäßig vielen Importen. Beides macht die eigene Währung kaputt. In einer Währungsunion könnte man hingegen darauf setzen, dass andere Staaten weniger Schulden aufnehmen, so dass die Inflation insgesamt unter Kontrolle bleibt. Viele der Importe werden außerdem aus der Währungsunion selbst bezogen, sodass sie keine negative Auswirkung auf den Wechselkurs haben. Es gibt also ein gutes Argument für Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung in Währungsunionen.
Gleichzeitig haben Staaten in einer Währungs- und Wirtschaftsunion einen Anreiz, zu wenig Schulden zu machen. Läuft die Wirtschaft schlecht, sind Schulden gut, um sie wieder anzukurbeln. In einer Währungs- und Wirtschaftsunion, in der viele Wirtschaften sehr eng miteinander verknüpft sind, kann man aber hoffen, dass die Nachbarstaaten die Schulden machen. Dann profitiert man von der zusätzlichen Nachfrage und dem Wirtschaftsaufschwung, hat aber später keine neuen Schulden zu bedienen und zurückzuzahlen.
Da damals der erste Anreiz als der stärkere beurteilt wurde, zielten die Regeln vor allem auf eine Begrenzung der Staatsverschuldung ab. Dem zweiten Anreiz wurde dadurch Rechnung getragen, dass die Mitgliedsstaaten ihre Wirtschaftspolitik eng koordinieren sollten. Dieser Grundsatz wurde 2011 in konkrete Zahlen und Vorgaben übersetzt, die jedoch von vielen Mitgliedsstaaten als weniger bindend betrachtet werden.

Die 2005 beschlossene Reform machte ein temporäres Überschreiten der 3%-Regel straffrei möglich, wenn dies aufgrund außergewöhnlich geringen oder negativen Wachstums geschieht. Dafür sollten die EU-Mitgliedsstaaten künftig ihre strukturelle Neuverschuldung generell auf 0,5% des BIP beschränken. So erhoffte man sich einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu der 3%-Grenze, so dass es zukünftig gar nicht erst zum Regelbruch kommen sollte. Außerdem sollte gesichert werden, „dass sich die Schuldenquote auf ein vertretbares Niveau zubewegt.“.

Vertiefung im Abschnitt: „Staatsschulden in der Europäischen Union“
Die 2005 eingeführte neue Regel bezog sich nicht mehr auf die Neuverschuldung, sondern auf die strukturelle Neuverschuldung. Während sich die Neuverschuldung einfach messen lässt, ist die strukturelle Neuverschuldung eine geschätzte Größe. Sie soll die Höhe der Neuverschuldung beziffern, die nicht der wirtschaftlichen Lage geschuldet ist. Höhere Ausgaben für das Arbeitslosengeld aufgrund einer schwachen Wirtschaft sollten also zum Beispiel ausgeklammert werden, genauso wie außergewöhnlich hohe Steuereinnahmen in einem Boom. Dahinter steht der Gedanke, dass der Staat in wirtschaftlich schwachen Zeiten die Wirtschaft mehr unterstützen soll, wie in Deutschland 2003 und 2004 geschehen. In guten Zeiten hingegen soll er die Wirtschaft bremsen, um eine Überhitzung und einen Anstieg der Preise zu vermeiden.
Die große Frage ist, wie man diese Bereinigung um die aktuelle wirtschaftliche Lage berechnet. Mehr dazu findet sich in Kapitel 2. Dort wird die Berechnung der Konjunkturkomponente der deutschen Schuldenbremse erklärt. Die Konjunkturkomponente entspricht der von der wirtschaftlichen Lage abhängigen erlaubten Verschuldung.

Kommission sucht Erfolgsprojekt
Parallel zu der europäischen Reform von 2005 gab es in Deutschland Diskussionen, ob man in der Haushaltspolitik von der Schweiz lernen könne. Dort führte man bereits 2001 eine Schuldenbremse ein. Zunächst wurde die Schuldenbremse aber von Expert:innen hierzulande abgelehnt.
2006 wurde von der Politik die Föderalismuskommission II eingesetzt. Die Aufgabe der Kommission war eine Neuordnung der finanziellen Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Erwartungen und Druck waren groß, die Erfolgsaussichten aufgrund der Komplexität der Bund-Länder-Finanzen eher gering. Man war auf der Suche nach einem gut kommunizierbaren Erfolgsprojekt. Da passte die Schuldenbremse bestens ins Beuteschema: Man konnte sie so gestalten, dass sie kompatibel mit den 2005 reformierten EU-Fiskalregeln war und als Antwort auf das grummelnde Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2007 dargestellt werden konnte.

Am 14. Februar 2008 präsentierte der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück der Föderalismuskommission einen Vorschlag: Eine an die EU-Schuldenregeln angelehnte Reform der grundgesetzlichen Schuldenregel. Was folgte, waren lange und zähe Debatten von Bund und Ländern untereinander – zunächst ergebnislos. Im Sommer 2008 drohte die Föderalismuskommission II sogar zu scheitern, da man sich in zentralen Punkten nicht einigen konnte.

2008: Die Krise
Am 15. September 2008 meldete die US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an. Die globale Finanzkrise breitete sich aus. Auch die Bundesregierung musste in großem Maß Schulden aufnehmen, um Banken zu stabilisieren und die Wirtschaft mit Konjunkturpaketen zu stützen.
Gleichzeitig gab es intensive politische und fachliche Verhandlungen. Die Föderalismuskommission II musste spätestens Mitte 2009 zu einem Ergebnis kommen, da im September desselben Jahres Bundestagswahlen anstanden. Haushaltspolitiker:innen der Unionsfraktion knüpften ihre Zustimmung zu den Konjunkturpaketen an die Einführung der Schuldenbremse.
Viel Zeit für eine Grundgesetzänderung verblieb allerdings nicht mehr. So einigte sich die Föderalismuskommission schließlich am 5. März 2009 auf einen konkreten Vorschlag: Die Schuldenbremse. Am 29. Mai 2009 wurde die Schuldenbremse mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag verabschiedet. Am 12. Juni 2009 folgte die Zustimmung des Bundesrates.

Vertiefung im Abschnitt: „2008: Die Krise“

Berlin – Sitzung in der Julius-Leber-Kaserne. Innerhalb von zwei Tagen sollten in der Klausurtagung der Föderalismuskommission II Ergebnisse erzielt werden. Der Druck war groß, denn das Ende der schwarz-roten Legislaturperiode rückte näher. Für eine Änderung des Grundgesetzes wurde die Zeit immer knapper.
Die neuen europäischen Fiskalregeln gaben vor, dass die jährliche strukturelle Neuverschuldung für den Gesamtstaat, also Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen auf 0,5 Prozent des BIP begrenzt werden sollte. Eine offensichtliche Lösung schien, Bund und Ländern (unter deren Zuständigkeit auch die Kommunen fallen) jeweils 0,25 Prozent Verschuldungsspielraum zuzuschlagen. Der Bund eröffnete daher die Verhandlungen mit 0,35 Prozent für sich und 0,15 Prozent für die Länder, in der Erwartung auf 0,25 Prozent heruntergehandelt zu werden. Das Ergebnis allerdings war ein anderes.
Das Hinterzimmer
Horst Seehofer, damals Ministerpräsident von Bayern, bestand auf eine Nullverschuldung für die Länder und konnte diese durchsetzen, da finanziell schwächere Länder auf Unterstützung angewiesen waren, um die Schuldenbremse zukünftig einhalten zu können. Diese sogenannten Konsolidierungshilfen gab es nur im Tausch gegen die Nullverschuldung.
Was genau in diesem Hinterzimmer besprochen wurde, ist bis heute unklar. Bemerkenswert ist: Ursprünglich waren Konsolidierungshilfen nur für Bremen, das Saarland und Schleswig-Holstein im Gespräch. Nach der Sitzung in der Julius-Leber-Kaserne fanden sich auch Berlin und Sachsen-Anhalt im Kreis der Begünstigten.


Pro und Contra Schuldenbremse


„Entscheidung von historischer Dimension“, sie helfe gegen den „Schraubstock der Verschuldung“. Peer Steinbrück (SPD) verteidigte die Schuldenbremse als Mittel der Wahl, den Staatshaushalt zu sanieren. Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) kritisierte die Einführung hingegen scharf: „Das Misstrauen, das künftigen demokratisch legitimierten Mehrheiten und Bundestag und Bundesrat und ihren möglichen Gestaltungsabsichten mit diesem Regelungsehrgeiz entgegengebracht wird“ hielt er „für verfassungspolitisch verfehlt“. Als einziges Mitglied der CDU/CSU-Fraktion stimmte er gegen die Einführung der Schuldenbremse.
Die Grünen unterstützten die Einführung einer Schuldenbremse, argumentierten aber für die Beibehaltung einer Goldenen Regel, also das Prinzip, für Nettoinvestitionen Neuverschuldung zuzulassen. Die Linke bezeichnete die Schuldenbremse als „Katastrophe für unser Land“ und „aktive Sterbehilfe für die Länder“.

Pro
Befürworter:innen der Schuldenbremse sehen die größte Gefahr für eine nachhaltige Finanzpolitik in übermäßigen Schulden. Übermäßige Schulden würden zum einen zukünftige finanzielle Spielräume einschränken und zum anderen zu hohen Zinskosten führen. Oft wird auch im Sinne der Generationengerechtigkeit argumentiert, dass man den Kindern doch keinen Schuldenberg hinterlassen solle.
Zudem erhoffte man sich bei der Einführung der Schuldenbremse, dass die Begrenzung der Neuverschuldung die Qualität der Ausgaben verbessern würde.
Die Schuldenbremse solle außerdem sicherstellen, dass die europäischen Fiskalregeln eingehalten werden und als Vorbild für das Ausland wirken.

Contra
Kritiker:innen argumentieren, dass Schulden notwendig sein können, um die Wirtschaft anzukurbeln, wie in der Krise 2008–2009 erneut bewiesen. Eine allgemeingültige Methode, um das dafür richtige Ausmaß an Kreditaufnahme oder -tilgung Jahr für Jahr festzustellen, gebe es aber nicht. Wie bereits im Kontext des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 1989 festgestellt, liefert die Volkswirtschaftslehre dafür „keine eindeutigen und sicheren Festlegungen“.
Weiterhin verhindere die Schuldenbremse notwendige Investitionen, etwa in Bildung und Infrastruktur. Damit gefährde sie das wirtschaftliche Potenzial und die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen. Die Kinder mögen nicht auf Schuldenbergen stehen, aber auf kaputter Infrastruktur. Die Rigidität der Schuldenbremse verhindere, dass Abwägungen über eine nachhaltige finanzpolitische Strategie – beispielsweise mit Blick auf Zinskosten – getroffen werden können. Die Hoffnung auf eine verbesserte Ausgabenqualität (zumeist ist hiermit ein größerer Fokus auf Investitionen und politische Prioritäten gemeint) habe sich nicht bewahrheitet.
Die Schuldenbremse sei außerdem wesentlich strenger als die europäischen Fiskalregeln. Die Messgröße „strukturelles Defizit“ sei sehr problematisch, was sich unter anderem daran zeige, dass die meisten EU-Mitgliedsstaaten sie nicht mehr nutzen wollen.
Die Schuldenbremse kann als undemokratisch gesehen werden, da sie zentrale – und teils inhärent politische – Entscheidungen über den Haushalt technischen Fachleuten im Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium (und nicht dem Parlament) überlässt. Teils wird ihre momentane Ausgestaltung sogar als nicht grundgesetzkonform ausgelegt. Zudem befördere sie kreative Buchhaltung und mache den Bundeshaushalt so zunehmend schwer verständlich.